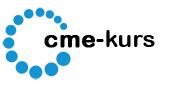Virologie und Pathogenese des RSV
Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) gehört zur Familie der Pneumoviridae, Gattung Orthopneumovirus. Es verfügt über ein negatives, einzelsträngiges RNA-Genom mit einer Größe von 15 Kilobasen, das für zehn Gene kodiert. Der RNA-Einzelstrang wird von einer Lipiddoppelschicht mit Glykoproteinen umgeben, wobei für die Infektion der Zielzelle das Adhäsionsprotein G und das Fusionsprotein F entscheidend sind. Das G-Protein bindet an Moleküle der Zelloberfläche von Zielzellen und existiert in zwei Subtypen. Daher unterscheidet man die beiden Virusgruppen RSV-A und RSV-B. Während der jährlichen Epidemie zirkulieren Virusstämme beider Gruppen, wobei RSV-A meist dominiert. Für die virale Invasionsmechanik wesentlich ist das hochkonservierte F-Fusionsprotein, das in zwei Konformationen vorkommt: 1. einer Präfusionsform (PreF), die als Zielstruktur für neutralisierende Antikörper dient, sowie 2. einer Postfusionsform (PostF), die weniger immunogen ist und für frühere Vakzin-Kandidaten verwendet wurde. Primärer Infektionsort sind respiratorische Epithelzellen im Nasopharynx und die Bronchien. Nach erfolgreicher Invasion führt die Virusreplikation zu zellulären Schäden, zu Exsudationen, Entzündungsreaktionen und Schleimbildung, worauf die klinischen RSV-Symptome basieren.
RSV in Deutschland
RSV-Infektionen treten zyklisch auf. Das RSV-Zirkulationsmuster weist generell eine klare Saisonalität auf. Beginnend im Oktober steigen die Fallzahlen bis Januar/Februar an, gefolgt von einem Rückgang bis März. Der Gipfel der RSV-Saison erstreckt sich über etwa vier bis acht Wochen und liegt meist im Januar und Februar, seltener auch im November und Dezember. Hochrechnungen zufolge waren im Jahr 2019 in Deutschland schätzungsweise 380.000 ältere Erwachsene von RSV-Infektionen betroffen. Die kumulativen Inzidenzen über alle Altersgruppen hinweg variierten in der Saison 2023/2024 je nach Bundesland zwischen 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner im Saarland und 216 Infektionen pro 100.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt. In Sachsen (172), Thüringen (119), Brandenburg (97), Mecklenburg-Vorpommern (95), Bayern (85) und Hamburg (75) lagen die Inzidenzen über der bundesweiten Infektionsrate (68/100.000), in den übrigen Bundesländern darunter. Die RSV-bedingten Hospitalisierungsraten und Todesfälle sind bei älteren Erwachsenen am höchsten. Neue Schätzungen besagen: Tritt bei Erwachsenen ab einem Alter von 60 Jahren eine RSV-Infektion auf, so wird von diesen jeder Vierte in ein Krankenhaus eingewiesen. Als Gründe werden der altersbedingte Rückgang der Immunabwehr sowie chronische respiratorische, kardiovaskuläre oder endokrin-metabolische Vorerkrankungen genannt. Im Vergleich zum Influenzavirus weist RSV in diesem Patientenkollektiv eine höhere Mortalität und Morbidität auf. Laut Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) liegt die Hospitalisierungsinzidenz aufgrund einer RSV-Erkrankung in Deutschland bei Menschen ab 60 Jahren bei 11,4/100.000 und bei Menschen ab 75 Jahren bei 21,2/100.000. Die Wahrscheinlichkeit, aufgrund einer RSV-Erkrankung im Krankenhaus zu versterben, beträgt dabei für 65- bis 74-Jährige 6,3 % und für 75- bis 79-Jährige 7,5 %. Weiterführende Daten aus populationsbasierten Studien und systematischen Reviews für das Jahr 2019 deuten zudem darauf hin, dass diese Werte, die auf Basis der Krankenhausentlassungsdiagnosen erhoben wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach um den Faktor 8 bis 14 höher sind.
Krankheitslast und gesundheitsökonomische Aspekte
Die größte Krankheitslast durch RSV besteht bei Säuglingen sowie bei älteren Erwachsenen ≥60 Jahren. Schätzungen zufolge gab es im Jahr 2019 weltweit 33 bis 60 Mio. RSV-assoziierte Erkrankungen der unteren Atemwege (LRTD) bei Kindern im Alter von null bis 60 Monaten, davon drei bis sechs Mio. in Krankenhäusern. Weiterhin wird von 26.300 RSV-assoziierten LRTD mit Todesfolge in Kliniken sowie von 101.400 RSV-bedingten Todesfällen ausgegangen. Bei älteren Erwachsenen ist RSV einer der wichtigsten viralen Erreger akuter Atemwegsinfektionen (ARI) und wird zunehmend als Krankheitsursache bei Hochrisikoerwachsenen, einschließlich solcher mit chronischen Lungen- und Herzerkrankungen, anerkannt. Eine Studie zeigte, dass eine RSV-Infektion bei 3 bis 7 % der gesunden älteren Erwachsenen und bei 4 bis 10 % der Hochrisikoerwachsenen auftrat. Zudem stieg auch die Rate der Hospitalisierungen wegen RSV-ARI mit dem Alter an. Vor allem bei Senioren kann sich eine RSV-Infektion langfristig signifikant auf die Konstitution und die Lebensqualität auswirken. Dies kann sich in kognitiven und physischen Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten oder in einer erhöhten Pflegebedürftigkeit manifestieren. Darüber hinaus stellt die Infektion eine Belastung für die Gesundheitssysteme dar. Insbesondere während der Wintermonate kommt es zu einer erhöhten Frequenz von Besuchen in den Notaufnahmen.
Symptomatik und klinischer Verlauf der RSV-Infektion
Die Übertragung von RSV erfolgt durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen von einer infektiösen Person auf eine Kontaktperson. Dabei bilden Bindehaut und Nasenschleimhäute die Eintrittspforte. Infizierte Personen sind in der Regel drei bis acht Tage lang ansteckend. Alle Altersgruppen können sich mit RSV infizieren; eine langfristige Immunität entsteht jedoch nicht. Besonders betroffen sind dabei Kinder und ältere Erwachsene. Zu den pädiatrischen Risikopatienten für eine schwere RSV-Infektion zählen Frühgeborene sowie Kinder mit pulmonalen Vorerkrankungen oder Herzfehlern mit vermehrter Lungendurchblutung. Darüber hinaus ist RSV einer der wichtigsten Erreger von Krankenhausinfektionen und einer Pneumonie bei Säuglingen und jungen Kleinkindern. Bei Erwachsenen kann eine RSV-Infektion unterschiedlich verlaufen: Möglich sind sowohl asymptomatische Ausprägungen als auch unkomplizierte Infektionen der oberen Atemwege. Dabei steigt die Hospitalisierungsrate aufgrund RSV-bedingter Erkrankungen mit dem Lebensalter an. Vor allem bei älteren Erwachsenen ab 60 Jahren kann die Infektion auch zu schweren Verläufen führen. Dabei spielen neben dem Alter vor allem chronische Vorerkrankungen und ein schwacher Immunstatus eine entscheidende Rolle.
Komplikationen einer RSV-Infektion
Mit zunehmendem Alter kommt es generell zu einer Verringerung der Immunfunktionen. Dieser als Immunseneszenz bezeichnete Prozess beruht auf einer Abnahme der Autophagie und der T-Zell-Produktion. In der Folge steigt die Anfälligkeit für bakterielle und virale Infektionen, zu deren Verursachern auch RSV zählt. Zudem ist das Risiko für einen schweren Verlauf einer RSV-Infektion bei immundefizienten und immunsupprimierten Personen erhöht. Studiendaten weisen darauf hin, dass ein altersbedingter Rückgang der RSV-spezifischen Antikörper und CD4+-T-Zellen mit einem erhöhten Risiko für eine schwere RSV-Erkrankung einhergeht. Zu den Risikofaktoren für schwere RSV-Infektionen bei Erwachsenen zählen ein höheres Alter, chronische Grunderkrankungen sowie ein geschwächtes Immunsystem durch Erkrankung oder Medikation. Studiendaten belegen, dass RSV-Infektionen bei Senioren zu längeren Krankenhausaufenthalten, einer erhöhten Komplikationsrate und letztlich zu einer höheren Mortalität führen als Influenzainfektionen. Eine RSV-Infektion kann zudem zu einer deutlichen Verschlechterung chronischer Vorerkrankungen führen. Klinische Studien haben gezeigt, dass ein Krankenhausaufenthalt wegen einer Atemwegserkrankung aufgrund einer RSV-Infektion bei 14 bis 22 % der erwachsenen Patienten durch kardiovaskuläre Ereignisse kompliziert wird, darunter eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz, ein akutes Koronarsyndrom und Herzrhythmusstörungen. Darüber hinaus ist eine zugrunde liegende kardiovaskuläre Erkrankung bei 45 bis 63 % der Erwachsenen mit bestätigter RSV-Infektion mit einer Krankenhauseinweisung verbunden. RSV löst unter anderem Entzündungsprozesse aus, die eine vermehrte Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine, eine Hyperkoagulierung und eine Plaquedestabilisierung fördern. Dies kann beispielsweise kardiovaskuläre Komplikationen zur Folge haben. Ein Vergleich zwischen RSV- und Influenzainfektionen bei hospitalisierten älteren Erwachsenen zeigte, dass RSV-Infektionen mit einem längeren Klinikaufenthalt, einem höheren Risiko für Atemnot und Lungenentzündung, einer Aufnahme auf die Intensivstation und einer 1-Jahres-Mortalität einhergehen.
Therapie der RSV-Infektion
Eine wirksame kausale Behandlung der RSV-Infektion existiert derzeit nicht. Historisch beschränken sich präventive Maßnahmen auf strenge Hygienemaßnahmen sowie auf eine passive, antikörperbasierte Immunisierung bei Hochrisikokindern. Die Therapie erfolgt symptomatisch und besteht aus einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zur Sekretmobilisation sowie zur Freihaltung des Nasenrachenraumes mit Kochsalznasenspülungen oder -tropfen. Je nach Zustand des Patienten können Sauerstoffgaben, Atemunterstützung, Intubation und Beatmung erforderlich sein. Eine antibakterielle Therapie ist nur indiziert, wenn eine bakterielle Ko- oder Sekundärinfektion vorliegt. Wichtig ist daher ein sorgfältiges Monitoring auf Anzeichen einer bakteriellen Infektion, wie beispielsweise eine sekundäre klinische Verschlechterung.
Impfstoffe zur aktiven Immunisierung gegen RSV
Lange gab es für RSV keine aktive Immunisierung. Bis Ende 2022 stand mit dem monoklonalen RSV-Antikörper Palivizumab lediglich eine Option für eine passive Immunisierung zur Verfügung. Dies hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Im Jahr 2023 wurden in der Europäischen Union (EU) erstmals zwei proteinbasierte RSV-Impfstoffe durch die Europäische Zulassungsbehörde zugelassen: RSVPreF3 OA (GSK) und RSVPreF (Pfizer). Beide Impfstoffe wurden zur RSV-Saison 2023/2024 bereitgestellt. Der erste Impfstoff RSVPreF3 OA ist für die aktive Immunisierung zur Prävention von RSV-verursachten LRTD bei Erwachsenen im Alter von 60 Jahren und älter sowie bei Erwachsenen im Alter von 50 bis 59 Jahren mit erhöhtem Risiko für eine RSV-Erkrankung zugelassen. Der zweite Impfstoff RSVPreF verfügt über eine aktuelle europaweite Zulassung für die aktive Immunisierung von Personen ab einem Alter von 18 Jahren zur Prävention von RSV-assoziierten LRTD, außerdem zur Immunisierung schwangerer Frauen zum passiven Schutz des Säuglings (ab Geburt bis zu einem Alter von sechs Monaten). RSVPreF3 OA repräsentiert eine adjuvantierte Vakzin-Formulierung, die ein rekombinantes RSV-Antigen mit dem Adjuvans AS01 kombiniert. Dagegen enthält der nicht adjuvantierte proteinbasierte RSVPreF-Impfstoff in gleichen Teilen stabilisiertes Präfusions-F-Antigen der RSV-Untergruppen A und B. Diese beiden proteinbasierten RSV-Vakzine richten sich gegen das rekombinante, in der Präfusionskonformation stabilisierte Glykoprotein F aus der Lipidhülle von RSV. Aktuell (Stand September 2025) sind in der EU, neben den beiden proteinbasierten Vakzinen, auch der mRNA-basierte RSV-Impfstoff mRNA-1345 (Moderna) zur Prävention von RSV-verursachten Erkrankungen der LRTD für Personen im Alter von 60 Jahren und älter sowie im Alter von 18 bis 59 Jahren mit erhöhtem Risiko für eine durch RSV verursachte LRTD zugelassen. Dieser besteht aus einem einzelsträngigen Boten-RNA-Molekül (Messenger RNA, mRNA) mit 5’-Cap-Struktur, das für das in der Präfusionskonformation stabilisierte RSV-A Glykoprotein F kodiert. Die mRNA ist in Lipidnanopartikel eingebettet, die der Stabilisierung der mRNA dienen und ihre Aufnahme in die Zellen erleichtern. Alle drei aktuell in der EU zugelassenen RSV-Impfstoffe richten sich gegen das in der Präfusionskonformation stabilisierte Glykoprotein F. Das RSVPreF-Antigen ähnelt der nativen Protein-F-Struktur in der Virushülle. Das Glykoprotein F ist für das Virus essenziell, um in die Wirtszelle einzudringen, indem es die feste Bindung und Verschmelzung der RSV-Lipidhülle mit der Membran der humanen Wirtszelle bewirkt. Dockt RSV an die Wirtszelle an und verschmilzt mit ihr, ändert sich die Präfusionskonformation des viralen Protein F zur Postfusionskonformation. Dies bewirkt eine sehr stabile Bindung an die Wirtszelle und das anschließende Eindringen des RSV in die Zielzelle. Auf diesem Weg stimulieren die drei verfügbaren RSV-Impfstoffe die Produktion von neutralisierenden Antikörpern gegen PreF der beiden Virussubtypen RSV-A und RSV-B und induzieren eine effiziente, antigenspezifische zelluläre und humorale Immunantwort unter Beteiligung von T-Lymphozyten. Dies trägt dazu bei, RSV-verursachte LRTD zu verhindern und Risikopatienten zu schützen.
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die RSV-Impfung als einmalige Standardimpfung für alle Personen ≥75 Jahre (EBM [Einheitlicher Bewertungsmaßstab] 89137) möglichst vor der RSV-Saison. Außerdem wird eine einmalige Indikationsimpfung für Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit Risikofaktoren oder mit schweren Grunderkrankungen sowie für Personen, die in Einrichtungen der Pflege leben und somit ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren RSV-Krankheitsverlauf haben, empfohlen (EBM 89138). Zu den Grunderkrankungen gehören schwere Formen von chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, der Nieren oder des Herz-Kreislauf-Systems sowie chronische neurologische und neuromuskuläre Erkrankungen, hämatoonkologische Erkrankungen, Diabetes mellitus (mit Komplikationen) sowie eine schwere angeborene oder erworbene Immundefizienz. Derzeit (Stand Juli 2025) sind in Deutschland drei RSV-Impfstoffe zugelassen. Die Impfung kann mit einem dieser drei RSV-Impfstoffe durchgeführt werden. Eine präferenzielle Empfehlung für einen der drei Impfstoffe spricht die STIKO nicht aus. Die RSV-Impfung ist keine jährliche Impfung. Auf Basis der aktuellen Datenlage kann von der STIKO derzeit noch keine Aussage zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen getroffen werden. Für einen optimalen Schutz in der RSV-Saison sollte die Impfung im Spätsommer/Herbst erfolgen. Die RSV-Impfung kann gleichzeitig mit der saisonalen Influenzaimpfung verabreicht werden. Ziel der RSV-Impfempfehlung ist die Reduktion schwerer RSV-assoziierter Atemwegserkrankungen sowie der daraus resultierenden Folgen wie Hospitalisierung und Tod.
Wirkung der derzeit zugelassenen RSV-Vakzine
Klinische Wirksamkeit bei Erwachsenen ab 60 Jahren
Die beiden proteinbasierten Vakzine RSVPreF3 OA und RSVPreF sowie der mRNA-basierte RSV-Impfstoff mRNA-1345 wurden in zulassungsrelevanten klinischen Studien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Sicherheit überprüft. In den drei Studien bestanden Unterschiede in den Studienprotokollen, so etwa in der Definition der Wirksamkeitsendpunkte. Daher sind keine direkten Vergleiche zwischen den drei RSV-Vakzinen möglich. Dennoch lassen sich die Wirksamkeitsdaten für die erste RSV-Saison nach Verabreichung des jeweiligen RSV-Impfstoffes zusammenstellen. In allen Studien waren Personen mit und ohne chronische Grunderkrankungen (Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Chronisch obstruktive Lungenerkrankung [COPD], Asthma) eingeschlossen. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes können alle aktuell empfohlenen RSV-Impfstoffe bei Personen ab 60 Jahren RSV-Erkrankungen unterschiedlicher Schweregrade mit hoher Wirksamkeit vorbeugen. In der Phase-III-Studie AreSVi-006 konnte an knapp 25.000 Studienteilnehmern (≥60 Jahre) gezeigt werden, dass eine aktive Immunisierung mit dem adjuvantierten Proteinimpfstoff RSVPreF3 OA eine hohe präventive Wirksamkeit gegen RSV-verursachte LRTD besitzt. Der Impfstoff war dabei gut verträglich. Primärer Endpunkt war die Wirksamkeit einer Einzeldosis des RSV-Vakzins RSV-PreF3 OA zur Prävention einer RSV-assoziierten LRTD. Bei insgesamt 47 Studienteilnehmern (7/12.466 im Impfstoffarm und 40/12.494 im Placeboarm) wurde eine bestätigte RSV-assoziierte LRTD diagnostiziert. Daraus resultierte eine Wirksamkeit des Impfstoffes von 82,6 % (96,95%-KI 57,9–94,1). Für das zweite proteinbasierte Vakzin RSVPreF ergab sich in der placebo-kontrollierten Phase-III-Studie RENOIR mit >34.000 Teilnehmenden im Alter von ≥60 Jahren (gesund oder mit etablierten Grunderkrankungen) ebenfalls eine gute Wirksamkeit von ca. 66,7 % bzw. 85,7 % gegen RSV-asssoziierte LRTD mit ≥2 bzw. ≥3 Symptomen. Für den mRNA-RSV-Impfstoff wurden Wirksamkeitsanalysen nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 8,6 Monaten durchgeführt. Dabei wurde eine Wirksamkeit gegen RSV-assoziierte LRTD mit ≥2 Symptomen von 62,5 % und für RSV-assoziierte LRTD mit ≥3 Symptomen von 61,1 % ermittelt.
Klinische Wirksamkeit bei vorerkrankten Erwachsenen
Einen besonderen Schutz liefert eine RSV-Impfung für Patienten mit ≥1 vorbestehenden studienrelevanten Grunderkrankung (u. a. COPD, Asthma, chronische Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus sowie fortgeschrittene Leber- oder Nierenerkrankung). Nach Gabe des adjuvantierten Impfstoffes RSVPreF3 OA sank das Risiko einer RSV-bedingten LRTD in der ersten Saison bei vorerkrankten Patienten um 94,6 % (95 %-KI 62,4–99,9) im Vergleich zu Placebo. Die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde mit einer Poisson-Methode kumulativ berechnet, mit Anpassung an die Saison, das Alter und die geografische Region. Im gleichen Zeitraum reduzierte eine Impfung mit dem nicht adjuvantierten Vakzin RSVPreF das Risiko für RSV-assoziierte LRTD mit ≥2 Symptomen um 62,5 % (96,66-% KI -8,4 bis 89,1) und für RSV-assoziierte LRTD mit ≥3 Symptomen um 75,0 % (96,66 %-KI -39,1 bis 97,9) bei Personen mit ≥1 Hochrisikoerkrankung bzw. -faktor. Dazu zählten Rauchen, Diabetes, Lungenerkrankungen (inklusive COPD und andere Lungenerkrankungen), Herzerkrankungen (inklusive Herzinsuffizienz und andere Herzerkrankungen), Leber- und Nierenerkrankungen. Die berichteten sekundären Endpunkte sowohl für den adjuvantierten Impfstoff RSV-PreF3 OA als auch den nicht adjuvantierten Impfstoff RSVPreF sind rein deskriptiv und nicht um den Effekt der Multiplizität korrigiert. Bei dem mRNA-basierten RSV-Impfstoff mRNA-1345 lag die Risikoreduktion für RSV-LRTD mit ≥2 Symptomen in der ersten RSV-Saison nach einem Follow-up von 8,6 Monaten bei 74,6 % (95 %-KI 50,7–86,9) bei Patienten mit ≥1 vorbestehenden studienrelevanten Grunderkrankung (wie COPD, Herzinsuffizienz, Asthma, chronische respiratorische Erkrankungen, Diabetes, fortgeschrittene Leber- und Nierenerkrankung). Die dafür relevanten klinischen Studiendaten beziehen sich dabei nicht auf einzelne Saisons, sondern liefern Nachbeobachtungszeiten. Zudem gab es keinen vordefinierten Endpunkt für schwere RSV-assoziierte LRTD.
Vakzin-Wirksamkeit nach der zweiten und dritten RSV-Saison
Ausführliche Ergebnisse wurden für den adjuvantierten Impfstoff RSVPreF3 OA publiziert: Studienteilnehmer zur Vakzin-Wirksamkeit über mehrere RSV-Saisons, die in der ersten Saison eine RSV-Impfung erhalten hatten, wurden für die zweite Saison auf zwei Gruppen aufgeteilt, um entweder eine weitere Impfung gegen RSV oder ein Placebo zu erhalten. Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17,8 Monaten zeigte eine Dosis des RSV-Impfstoffs RSVPreF3 OA eine kumulative Schutzwirkung von 67,2 % (97,5 %-K: 48,2–80,0) gegen RSV-bedingte LRTD sowie von 78,8 % (95 %-K: 52,6–92,0) gegen schwere RSV-bedingte LRTD über zwei Saisons. Die Verabreichung einer zweiten Impfstoffdosis vor Beginn der zweiten Saison hatte keinen zusätzlichen Nutzen in Bezug auf die Schutzwirkung: Bei den zweimal geimpften Teilnehmern lag der Schutzeffekt bei 67,1 % (97,5 %-KI 48,1–80,0) gegen RSV-LRTD und bei 78,8 % (95 %-KI 52,5–92,0) gegen schwere RSV-LRTD. Dabei waren Reaktogenität und Sicherheit der Auffrischungsimpfung vergleichbar mit denen der ersten Dosis. Auch für die dritte Saison nach der Impfung wurden die Teilnehmer der Verumgruppe mit denen der Placebogruppe verglichen, allerdings ohne erneute Impfung. Der Auswertung zufolge verleiht RSVPref3 OA (vs. Placebo) bereits nach einer Injektion eine kumulierte Schutzwirkung für drei Saisons von 62,9 % (97,5 %-KI 46,7–74,8) gegen LRTD. Der durch eine einzige Dosis RSVPreF3 OA vermittelte Impfschutz war über drei RSV-Saisons hinweg bei Personen im Alter von 60 Jahren oder älter wirksam gegen RSV-bedingte LRTD, trotz einer mit der Zeit leicht abnehmenden Wirksamkeit. Weiterhin liegen auch für den nicht adjuvantierten Impfstoff RSVPreF Wirksamkeitsdaten für zwei Saisons vor. Für die zweite RSV-Saison mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 16,4 Monaten lag die Impfstoffwirksamkeit (IW) gegen RSV-assoziierte LRTD mit ≥2 Symptomen bei 58,8 % (95 %-KI 43,0–70,6; mit 54 Fällen in der RSVPreF-Gruppe und 131 Fällen in der Placebo-Gruppe) sowie mit ≥3 Symptomen bei 81,5 % (95%-KI 63,3–91,6; mit 10 Fälle in der RSVPreF-Gruppe und 54 Fällen in der Placebo-Gruppe). Die IW gegen RSV-assoziierte LRTD, verursacht durch RSV-A bzw. RSV-B, betrug 66,3 % (95 %-KI 47,2–79,0) bzw. 50,0 % (95 %-KI 18,5–70,0) für Fälle mit ≥2 LRTD-Symptomen und 80,6 % (95 %-KI 52,9–93,4) bzw. 86,4 % (95 %-KI 54,6; 97,4) für Fälle mit ≥3 LRTD-Symptomen. Für den mRNA-basierten RSV-Impfstoff mRNA 1345 stehen derzeit nur begrenzte Daten zur Verfügung. So wird dessen Wirksamkeit bei der Vermeidung von RSV-bedingten LRTD mit ≥2 Symptomen in einer 24-Monats-Analyse auf 47,4 % (95 %-KI 35,0–57,4) beziffert.
Nebenwirkungsprofile der zugelassenen RSV-Vakzine
Daten zur Verträglichkeit und Sicherheit der drei aktuell zugelassenen RSV- Impfstoffe basieren auf verschiedenen, impfstoffspezifischen, placebokontrollierten klinischen Studien mit Erwachsenen. Das Nebenwirkungsprofil von RSVPreF3 OA basiert auf Datenerhebungen bei erwachsenen Personen im Alter von ≥60 Jahren bzw. im Alter von 50 bis 59 Jahren nach Verabreichung einer Impfstoffdosis sowie auf Erfahrungen nach der Markteinführung des Impfstoffes. Das Sicherheitsprofil des Vakzins RSVPreF beruht auf Studiendaten nach Gabe einer Einzeldosis des Vakzins an schwangere Frauen zwischen den Schwangerschaftswochen 24 bis 36 sowie an Personen ab einem Alter ≥18 Jahren. Die Sicherheitssignale des mRNA-Impfstoffes wurden in einer Phase-II/III-Studie nach Injektion einer Dosis des Impfstoffes an Erwachsenen im Alter von ≥60 Jahren zusammengestellt. Am häufigsten traten Schmerzen an der Injektionsstelle, Fatigue, Myalgien und Arthralgien sowie Kopfschmerzen auf. Die Nebenwirkungen waren in der Regel von leichtem bis moderatem Schweregrad und gingen innerhalb weniger Tage (ein bis zwei Tage; bei Schwangeren innerhalb von ein bis drei Tagen) nach der Impfung vollständig zurück. Dauer und Schweregrad der beobachteten Ereignisse waren in allen Altersgruppen vergleichbar. Laut einem im April 2025 veröffentlichten Faktenblatt des Robert Koch-Institutes zu RSV-Impfungen können nach Gabe eines RSV-Vakzins übliche Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle oder Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. In einer Postmarketing-Überwachung der beiden proteinbasierten RSV-Impfstoffe in den USA wurde außerdem ein erhöhtes Auftreten von Guillain-Barré-Syndromen (GBS) im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung beobachtet (bis zu 25 GBS-Fälle pro einer Mio. verabreichter Impfdosen). Verlässliche Schätzungen zur Höhe dieses Risikos, insbesondere in verschiedenen Altersgruppen, gibt es bisher nicht. Außerdem wurde ein mögliches Sicherheitssignal für das Auftreten einer Immunthrombozytopenie erfasst. Ein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung konnte allerdings bisher nicht bestätigt werden. Beim mRNA-RSV-Impfstoff wird eine periphere Fazialisparese als seltene Nebenwirkung beschrieben, wobei diese in der zugrunde liegenden Studie in der Impfstoff- und der Placebogruppe ähnlich häufig auftrat.
Praktisches Impfmanagement
Seit September 2024 ist die RSV-Impfung als einmalige Standardimpfung für alle Personen ≥75 Jahre (EBM 89137) sowie als einmalige Indikationsimpfung für Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit schweren Ausprägungen von chronischen Erkrankungen und für Personen, die in einer Einrichtung der Pflege leben und somit ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren RSV-Krankheitsverlauf haben, eine Pflichtleistung (EBM 89138). Durch die Aufnahme der RSV-Impfung in die Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und deren Veröffentlichung im Bundesanzeiger wurde die RSV-Impfung für diese Personengruppen gemäß der STIKO-Empfehlung zur Pflichtleistung der Krankenkassen für alle gesetzlich oder privat Versicherten. Die RSV-Impfstoffe werden als Einmaldosis intramuskulär verabreicht. Dabei können proteinbasierte RSV-Impfstoffe gleichzeitig mit der saisonalen Influenzaimpfung injiziert werden. Der proteinbasierte RSVPreF3 OA-Impfstoff kann gleichzeitig mit inaktivierten saisonalen Grippeimpfstoffen (standarddosiert nicht adjuvantiert, hochdosiert nicht adjuvantiert oder standarddosiert adjuvantiert) verabreicht werden. Wenn er gleichzeitig mit einem anderen injizierbaren Impfstoff verabreicht wird, sollten die Impfstoffe immer an unterschiedlichen Injektionsstellen gespritzt werden. Auch der proteinbasierte RSV-Impfstoff RSVPreF kann gleichzeitig mit saisonalen Grippeimpfstoffen (standarddosierte, adjuvantierte oder nicht adjuvantierte Hochdosisinfluenzaimpfstoffe) sowie mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen mit oder ohne einen gleichzeitig verabreichten Hochdosisgrippeimpfstoff (nicht adjuvantiert) gegeben werden. Zur Koadministration des mRNA-RSV-Impfstoffes mit der saisonalen Influenzaimpfung liegen noch keine Daten vor. Bei anderen mRNA-Impfstoffen, wie den gegen SAS-CoV-2 gerichteten Vakzinen, wurden bisher jedoch keine schwerwiegenden Unverträglichkeiten bei einer Koadministration beschrieben.
Erstattungsfähigkeit von RSV-Impfstoffen
Mit der Aufnahme der RSV-Impfung in die Schutzimpfungs-Richtlinie, die den Empfehlungen der STIKO folgt, haben folgende Versicherte einen Anspruch auf eine Impfung mit einem proteinbasierten oder mRNA-basierten RSV-Impfstoff: Alle Personen ab einem Alter von 75 Jahren sowie Personen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit schweren Ausprägungen von chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, chronischen Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, hämatoonkologischen Erkrankungen, Diabetes mellitus mit Komplikationen, einer chronischen neurologischen oder neuromuskulären Erkrankung oder einer schweren angeborenen oder erworbenen Immundefizienz. Ebenso haben Bewohner von Pflegeeinrichtungen im Alter von 60 bis 74 Jahren einen Anspruch auf eine RSV-Impfung. Für alle gesetzlich Versicherten kann der jeweilige RSV-Impfstoff gemäß der STIKO-Empfehlung über den Sprechstundenbedarf verordnet werden. Diese Option besteht seit dem 31.07.2025 für alle Krankenversicherungs-(KV-)Regionen. Die Ver sicherten müssen nicht in Vorleistung treten. Für privat Versicherte und Patienten außerhalb der STIKO-Empfehlung besteht zudem die Möglichkeit, den RSV-Impfstoff durch ein Privatrezept zu verordnen. Die Versicherten können das quittierte Privatrezept bei der Krankenkasse zur freiwilligen Erstattung einreichen.
Fazit
- RSV-Infektionen werden häufig unterschätzt und gefährden insbesondere Säuglinge, Kleinkinder und ältere Erwachsene.
- Die Zulassung von RSV-Impfstoffen stellt einen Meilenstein in der Prävention schwerer LRTD bei älteren Erwachsenen dar.
- Mit einer Wirksamkeit gegen LRTD, einem robusten Immunogenitätsprofil und einem akzeptablen Sicherheitsprofil bieten moderne Impfstoffe eine effektive Option zur Risikoprävention.
- Die STIKO-Empfehlungen für Einmalimpfungen bei Personen ab 75 Jahren und Indikationsgruppen ab 60 Jahren sind fundiert und sozialversicherungsrechtlich abgesichert.
- Ergänzende Langzeitdaten zur Immunpersistenz und zur Notwendigkeit von Boosterimpfungen werden einer weiteren Optimierung der RSV-Impfstrategien dienen.
Bildnachweis
luciano – Adobe Stock